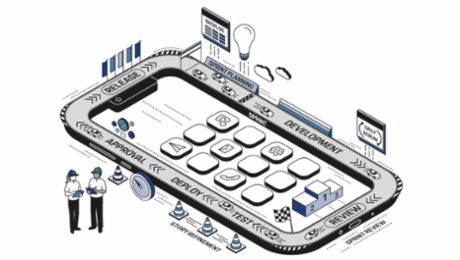Wie weit wird Ihrer Meinung nach die KI-Entwicklung gehen und welche Rolle wird sie in unserer Gesellschaft spielen? Gibt es spezifische Grenzen der KI-Entwicklung?
Dirk Lappe: Künstliche Intelligenz hat beeindruckende Fortschritte gemacht, aber es gibt Grenzen im Vergleich zur menschlichen Erfindungsfähigkeit. KI ist stark in Mustererkennung, Datenanalyse und der Ausführung spezifischer, gelernter Aufgaben. Aber Kreativität und Innovation, wie sie Menschen zeigen, sind für KI schwierig. KI kann Daten basierend auf früheren Informationen verarbeiten, aber sie kann nicht wie Menschen völlig neue Ideen oder Konzepte erschaffen. Die menschliche Fähigkeit, aus Erfahrung zu lernen, Intuition und emotionale Intelligenz zu nutzen, bleibt einzigartig. Die Intelligenz der bewussten Wahrnehmung, also das Bewusstsein über die eigene Existenz und die Fähigkeit, Erfahrungen subjektiv zu verarbeiten, ist in Bezug auf KI eine große Herausforderung. Aktuelle KI-Systeme können auf Basis von Algorithmen und maschinellem Lernen Daten verarbeiten und sogar Entscheidungen treffen. Aber sie besitzen kein Bewusstsein im menschlichen Sinne.
Federico Magno: Unser Bewusstsein umfasst auch die Emotionen und für die bin ich als Italiener sozusagen Experte. Zu den Emotionen gehören Dinge wie Selbstbewusstsein, subjektive Erfahrungen und das Verständnis von sich selbst im Kontext der Welt. Diese Aspekte sind tief verwurzelt in der menschlichen Psychologie und verankert in unseren Hirnen. KI-Systeme haben keine persönlichen Erfahrungen, sie wissen sozusagen nicht, was sie tun – oder besser: getan haben. Ihre Aktionen sind gefühllos. Diese sogenannte selbstreferenzielle Intelligenz des Menschen ist eine weitere faszinierende Eigenschaft. Sie bezieht sich darauf, wie Menschen über sich selbst nachdenken, Selbstbewusstsein entwickeln und ihre eigenen mentalen Prozesse verstehen und reflektieren.

Was ist denn das Besondere daran?
Magno: Man sagt: Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung. Und wenn man das wörtlich nimmt, beschreibt es eigentlich ganz schön, was uns von Künstlicher Intelligenz zumindest momentan noch unterscheidet: Weil wir uns selbst erkennen, können wir aus Fehlern lernen. Diese Art der Intelligenz ist einzigartig komplex, da sie nicht nur kognitive Fähigkeiten umfasst, sondern auch emotionale und soziale Aspekte. Maschinen können diese Art von Intelligenz kaum nachahmen. KI-Systeme können programmiert werden, um ihre Leistung zu analysieren und sich an bestimmte Aufgaben anzupassen. Doch das ist eine kalte Selbstoptimierung, quasi blutleer, ohne Emotionen. Sie haben eben kein Bewusstsein ihrer selbst im menschlichen Sinne.
Und was heißt das für die Fahrzeuge der Zukunft?
Lappe: In Bezug auf zukünftige Entwicklungen, wie etwa im Fahrzeug der Zukunft, könnte man spekulieren, dass KI in bestimmten Bereichen menschenähnliche Fähigkeiten erreichen oder sogar übertreffen könnte. Dennoch gilt, dass Aspekte wie kreatives Denken, Empathie und allgemeine Problemlösungsfähigkeit wahrscheinlich Grenzen darstellen werden, die schwer durch KI zu überschreiten sind. Die Zukunft des automatisierten Fahrens sieht dennoch vielversprechend aus. Neben KI gibt es eine starke Entwicklung in der Sensorik. Diese Fortschritte könnten zu sichererem und effizienterem Straßenverkehr führen. Außerdem könnten automatisierte Fahrzeuge die Mobilität für Menschen verbessern, die selbst nicht fahren können oder wollen. Allerdings gibt es neben der technischen Komplexität auch Herausforderungen, wie etwa rechtliche Fragen, Datenschutz und die Akzeptanz in der Gesellschaft.

Welche Rolle spielt dabei die von Herrn Magno gerade beschriebene selbstreferenzielle Intelligenz?
Lappe: Selbstreferenzielle Intelligenz, wie sie beim Menschen vorkommt, ist für das autonome Fahren nicht unbedingt erforderlich. Autonome Fahrzeuge basieren auf KI-Systemen, die Umgebungsinformationen verarbeiten und darauf reagieren, aber sie benötigen kein Selbstbewusstsein oder Verständnis ihrer eigenen Existenz. Für autonomes Fahren sind andere Aspekte der KI wichtiger, wie etwa die Fähigkeit, die Umgebung genau zu erfassen, wie andere Fahrzeuge, Fußgänger, Verkehrsschilder und Straßenbedingungen. Außerdem ist die Fähigkeit, basierend auf sensorischen Daten und programmierten Algorithmen sichere und effiziente Entscheidungen zu treffen, von Bedeutung. Und schließlich die Fähigkeit, sich an unterschiedliche Verkehrsbedingungen und unvorhersehbare Ereignisse anzupassen.
Diese Fähigkeiten ermöglichen es autonomen Fahrzeugen, sicher zu navigieren und zu operieren, ohne dass eine selbstreferenzielle Intelligenz erforderlich ist. Wenn beim autonomen Fahren nicht alle Daten für die Wahrnehmung verfügbar sind, gibt es mehrere Herausforderungen und Lösungsansätze. Autonome Fahrzeuge sind oft mit redundanten Systemen ausgestattet, wie mehreren Sensoren und Kameras. Wenn ein Sensor ausfällt, können andere die fehlenden Daten kompensieren. Bei unzureichenden Daten neigen autonome Systeme dazu, vorsichtiger zu fahren, zum Beispiel langsamer zu fahren oder anzuhalten, bis mehr Informationen verfügbar sind. Fahrzeuge können aus vergangenen Erfahrungen lernen, um besser mit unvollständigen Daten umzugehen. Vernetzung mit anderen Fahrzeugen oder Verkehrsinfrastruktur kann zusätzliche Informationen liefern. Die Sicherheit ist dabei immer das oberste Ziel.

Und wie ist es mit der vollständig fahrerlosen Mobilität?
Lappe: Das sollten wir kurz einordnen: Es gibt bekanntlich fünf Level des automatisierten Fahrens. Jedes Level bringt mehr Automatisierung und weniger Notwendigkeit für menschliches Eingreifen mit sich. Level 1 – Assistiert: Hier gibt es Systeme wie Tempomat oder Spurhalteassistent, aber der Fahrer muss ständig eingreifen und die Kontrolle behalten. Level 2 – Teilautomatisiert: Das Fahrzeug kann bestimmte Aufgaben wie Lenken, Beschleunigen und Bremsen übernehmen, aber der Fahrer muss immer noch die Umgebung überwachen und bereit sein, zu übernehmen. Level 3 – Bedingt automatisiert: Das Auto kann unter bestimmten Bedingungen selbst fahren, der Fahrer muss jedoch bereit sein, bei Bedarf die Kontrolle zu übernehmen. Level 4 – Hochautomatisiert: Das Fahrzeug kann in den meisten Situationen selbstständig fahren, ohne dass der Fahrer eingreifen muss. Es kann jedoch noch eine Option für manuelles Fahren geben.
Magno: Und dann kommen wir schließlich zur „Königsklasse“. Zu Level 5, dem vollautomatisierten Fahren: Hier übernimmt das Fahrzeug alle Fahraufgaben unter allen Bedingungen. Es gibt grundsätzlich keine Notwendigkeit für einen Fahrer oder ein Lenkrad. Und eben das wird sich in den nächsten Jahren aufgrund der dafür notwendigen Datenmengen und Rechenleistungen sowie der erforderlichen, sehr teuren Sensorik als sehr schwierig erweisen. Autonom fahrende Fahrzeuge sind stark von der vorhandenen und gelernten Datenmenge und ihrer Aktualität abhängig. Ein Großteil der Daten muss vom Fahrzeug ständig selbst erfasst werden. Aber für die Analyse dieser Datenmengen legt ein autonomes Fahrzeug virtuell Millionen Kilometer in Simulationen zurück und lernt dabei, die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Was genau unterscheidet das System dabei vom Menschen?
Magno: Im Prinzip erst mal gar nicht so viel: Auch der Mensch erfasst mit seinen Sinnen die Umgebung, den Verkehr, Straßenverhältnisse, Schilder und die Ausmaße seines Fahrzeugs. Vorhandene Daten, etwa das Wissen, wo eine Straße ist oder wo man abbiegen kann, gibt es relativ wenige. Und sie sind leicht zu erweitern, etwa mit einem altmodischen Stadtplan. Aber ein Mensch muss für seinen Führerschein ja nicht mehrere Millionen Kilometer fahren. Die Anforderungen an den Führerschein beinhalten in der Regel eine bestimmte Anzahl an Fahrstunden und theoretischem Unterricht, gefolgt von einer praktischen und einer theoretischen Prüfung. Den Rest können Menschen mit ihrer selbstreferenziellen Intelligenz ausgleichen. Er muss nicht jede Situation einmal erlebt haben, um zu wissen, wie er handelt. Ob ein roter oder ein grüner Ball auf die Straße rollt, ist egal: Ein Mensch hält an, weil er ein Kind erwartet, das hinterherrennt. Ein autonomes Fahrzeug muss beide Situationen erst lernen. Und das ist ein einfaches Beispiel. Es ist aus heutiger Sicht nicht sicher, ob vollautonome Fahrzeuge in Simulationen und Tests für Level 5 jemals alle notwendigen Antworten werden finden können.
Herr Lappe, wie will Porsche Engineering in der Zukunft den Fortschritt in der Mobilität beeinflussen?
Lappe: Mit Mut! Wie in den letzten Jahren werden wir auch in Zukunft Mut in der Entwicklung zeigen und immer wieder neue Wege einschlagen – denn das ist der beständige Treibstoff für Innovation, Fortschritt und positive Veränderungen. Jede Entwicklung, sei es in technologischen, wissenschaftlichen oder gesellschaftlichen Bereichen, erfordert oft den Einsatz von Mut. Mut in der Entwicklung ist mehr als nur eine persönliche Eigenschaft. So ist Mut zum Beispiel der Motor der Innovation. Er motiviert Entwickler dazu, neue Ideen zu erforschen und innovative Lösungen zu schaffen, die die bestehenden Grenzen des Bekannten überschreiten. Ohne Mut würden viele wegweisende Entdeckungen und Erfindungen niemals Realität werden.

Herr Magno, wie blicken Sie auf die Zukunft der Mobilität?
Magno: Die Entwicklung der Mobilität war schon immer von vielen Unsicherheiten und nicht zu unterschätzenden Risiken geprägt. Doch das Risiko zu scheitern ist heute ein finanzielles und glücklicherweise kein lebensbedrohliches mehr, wie zum Beispiel in den ersten Jahren des Luftverkehrs. Auch dafür sorgt KI, die uns bei Simulationen hilft, seltene Fehler besser zu finden, die früher möglicherweise katastrophal geendet hätten. Mutige Unternehmer betrachten solche Fehler nicht als unüberwindbare Hindernisse oder als Zeichen des Scheiterns. Stattdessen sehen sie Fehler als wertvolle Gelegenheiten, aus ihnen zu lernen und sich zu verbessern. Und dann ein Produkt für alle Menschen daraus zu entwickeln.
Das klingt danach, als sei Mut für Sie beide der zentrale „Enabler“ für neue Entwicklungen und Innovationen, auch in der Mobilität …
Lappe: Richtig. Entwicklung kann auf zahlreiche Hindernisse und Herausforderungen stoßen. Mut befähigt Entwickler dazu, diese Hindernisse zu überwinden, kreative Lösungen zu finden und sich den größten Schwierigkeiten zu stellen. In einer sich ständig wandelnden Welt ist es erforderlich, sich an neue Technologien, Trends und Kundenbedürfnisse anzupassen. Mutige Entwickler sind offen für Veränderungen und bereit, bestehende Konzepte und Geschäftsmodelle zu überdenken.
Magno: Und es geht noch weiter: Mutige Entwickler und Unternehmer haben die Kraft, andere zu inspirieren. Sie zeigen, dass es möglich ist, Risiken einzugehen und visionäre Ideen in die Tat umzusetzen. Ihr Handeln ermutigt andere, ebenfalls mutig zu sein und innovative Wege zu beschreiten. Mutige Entwicklung kann weitreichende gesellschaftliche Veränderungen bewirken, indem sie Lösungen für drängende soziale Probleme bietet. Beispiele reichen von medizinischen Durchbrüchen bis hin zu nachhaltigen Umweltinitiativen.

Lappe: Nicht zuletzt ist Mut ein Schlüssel zur Förderung von persönlichem und beruflichem Wachstum. Und gleichzeitig treibt er den Fortschritt in der Entwicklung und den gesellschaftlichen Fortschritt insgesamt voran.
Magno: In einer zunehmend globalisierten Welt sind solche Wettbewerbsvorteile entscheidend. Mutige Unternehmer sind oft in der Lage, sich von der Konkurrenz abzuheben, neue Märkte zu erschließen und innovative Produkte oder Dienstleistungen anzubieten. Ihr Mut fördert ein positives Arbeitsumfeld, in dem Menschen bereit sind, kreative Ideen zu teilen und innovative Projekte zu verfolgen.
Lappe: Zusammenfassend ist Mut in der Entwicklung ein treibender Faktor für Veränderung und Fortschritt in der Mobilität der Zukunft. Er ermutigt uns, Herausforderungen zu meistern und die Welt durch innovative Ideen und Lösungen zu gestalten. Mutige Entwicklung ist ein Antrieb für positive Veränderungen und sollte daher in jeder Phase der Entwicklungsarbeit gefördert und geschätzt werden. Es ist der Schlüssel zu einer besseren Zukunft.
Und wie sieht es mit der Zukunft der KI aus?
Lappe: Die Zukunft der KI in der Automobilentwicklung ist vielversprechend und vielfältig, nicht nur für das autonome Fahren. KI hat das Potenzial, zur Verbesserung der Sicherheitssysteme in Fahrzeugen beizutragen, indem sie Gefahren schneller erkennt und präventive Maßnahmen initiiert. Fahrzeuge könnten basierend auf den Bedürfnissen individuell angepasst werden, was zu einem neuen Fahrerlebnis führt. In der Entwicklung und Fertigung können KI-Systeme Prozesse optimieren, Ressourcen einsparen und die Produktqualität erhöhen. KI ist in der Lage, Wartungsbedarf vorhersagen, was zur Reduzierung von Ausfallzeiten und zur Verlängerung der Lebensdauer von Fahrzeugkomponenten führt. Zusätzlich werden wir fortschrittlichere Vernetzungsfunktionen im Auto erleben, einschließlich Big-Data-Anbindung und IoT-Anwendungen. Mittels KI sind wir in der Lage, Fahrzeuge umweltfreundlicher zu gestalten, indem sie den Kraftstoffverbrauch optimiert und bei der Entwicklung von Elektrofahrzeugen unterstützt. Insgesamt wird die KI die Automobilentwicklung revolutionieren, indem sie Fahrzeuge sicherer, effizienter und benutzerfreundlicher macht.
Magno: Langfristig sind weitere, große Innovationsschritte in Sicht. Neuromorphische Systeme, welche die Strukturen und Funktionen des menschlichen Gehirns nachahmen, könnten in der Zukunft eine Schlüsselrolle in der Weiterentwicklung von KI-Technologien spielen. Solche Chips könnten effizienter und schneller als herkömmliche Prozessoren sein, insbesondere bei der Verarbeitung von sensorischen Daten. Sie könnten Entscheidungsfindungen in Echtzeit ermöglichen – und damit dem Menschen in seiner Entscheidungsfreude nahekommen. Diese Systeme sind darauf ausgelegt, komplexe, unstrukturierte Daten, wie sie in der realen Welt vorkommen, besser zu verarbeiten. Das wird die Zukunft der Mobilität prägen. Nicht nur in Form von vollautonomen Fahrzeugen mit Level 5. Sondern auch in der Art, wie Mobilität organisiert wird und welche neuen Geschäftsmodelle sich herausbilden. Wir wissen: KI hat die Kraft, Geschäftsprozesse zu revolutionieren. Jedenfalls wenn man sie richtig einsetzt. Und auch dafür bedarf es eines gewissen Mutes.
Lappe: Physikalische Rechenmodelle, die natürliche Prozesse nachahmen, können ebenfalls dazu beitragen, effizientere und robustere KI-Systeme zu entwickeln. Solche Modelle könnten in der Lage sein, mit Unsicherheiten und unvollständigen Informationen besser umzugehen, was für autonomes Fahren entscheidend ist. Diese Technologien sind vielversprechend, stehen aber noch am Anfang ihrer Entwicklung. Sie könnten zu signifikanten Durchbrüchen in der KI führen, insbesondere in Bezug auf Flexibilität, Lernfähigkeit und Anpassungsfähigkeit.
Magno: Die Entwicklung einer KI mit bewusster Wahrnehmung oder gar selbstreferenzieller Intelligenz wäre ein enormer Sprung. Aber sie wirft natürlich auch viele rechtliche, ethische, philosophische und technische Fragen auf, denen wir uns stellen müssen.
Lappe: Wir werden große Fortschritte der autonom fahrenden Fahrzeuge bis Level 4 erleben und hochqualitative und sichere Produkte realisieren. Wir werden jedoch schon aufgrund der nicht vorhandenen Vollständigkeit der Daten noch viele Jahrzehnte verhältnismäßig wenige Fahrzeuge mit Level 5 auf den Straßen sehen. Die meisten Fahrzeuge werden auch zukünftig ein Lenkrad besitzen, mit dem der intelligente Mensch bei Bedarf die Künstliche Intelligenz überstimmen und das Fahrzeug sicher übernehmen kann.
Info
Text erstmals erschienen im Porsche Engineering Magazin, Ausgabe 1/2024.
Text: Porsche Engineering
Fotos: Nói Crew
Copyright: Alle in diesem Artikel veröffentlichten Bilder, Videos und Audio-Dateien unterliegen dem Copyright. Eine Reproduktion oder Wiedergabe des Ganzen oder von Teilen ist ohne die schriftliche Genehmigung der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG nicht gestattet. Bitte kontaktieren Sie newsroom@porsche.com für weitere Informationen.
.jpg/jcr:content/S44-NOI_230919_PorscheMagazin_0047_278A5652-Final%20(1).jpg)